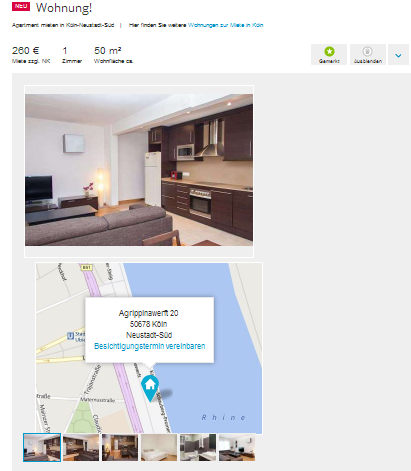Papst Franziskus betete so wie immer den sonntäglichen Angelus mit den Gläubigen auf dem Petersplatz. Zuvor hielt er die folgende Ansprache:
Liebe Brüder und Schwestern,
einen guten Tag bei diesem strahlenden Sonnenschein!
Der Abschnitt aus dem Evangelium dieses Sonntags setzt sich aus zwei Teilen zusammen: aus einem, in dem beschrieben wird, wie die Nachfolger Christi nicht sein sollen, und aus einem anderen, in dem das beispielhafte Idealbild eines Christen vorgestellt wird.
Beginnen wir mit dem ersten, nämlich was wir nicht tun sollen. Im ersten Teil lastet Jesus den Schriftgelehrten, den Lehrern des Gesetzes, drei Fehler an, die in ihrem Lebensstil offenbar werden: Hochmut, Habgier und Heuchelei. Sie, so die Worte Jesu, »lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt, und sie wollen in der Synagoge die vordersten Sitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben« (Mk 12,38-39). Doch hinter einem so erhabenen Schein verbergen sich Falschheit und Ungerechtigkeit. Während sie sich in der Öffentlichkeit aufplustern, nutzen sie ihre Macht, um die »Witwen um ihre Häuser zu bringen« (vgl. V. 40), die zusammen mit den Waisen und Fremden als die wehrlosesten und schutzlosesten Menschen angesehen wurden. Schließlich »verrichten [die Schriftgelehrten] in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete« (V. 40).
Auch heute besteht die Gefahr, derartige Haltungen anzunehmen. Zum Beispiel wenn man Gebet und Gerechtigkeit voneinander trennt, denn man kann nicht Gott anbeten und den Armen Schaden zufügen. Oder wenn man behauptet, Gott zu lieben, und ihm dagegen seine eigene Eitelkeit, den eigenen Vorteil voranstellt.
Und auf dieser Linie steht der zweite Teil des heutigen Evangeliums. Die Szene spielt sich im Tempel von Jerusalem ab, genau gesagt an dem Ort, an dem die Leute Geld als Opfergabe in einen Kasten warfen. Da sind viele Reiche, die viel geben, und dann ist da eine arme Frau, eine Witwe, die gerade einmal etwas Kleingeld, zwei kleine Münzen hineinwirft. Jesus beobachtet jene Frau aufmerksam und lenkt die Aufmerksamkeit seiner Jünger auf den offensichtlichen Gegensatz der Szene. Die Reichen haben unter großer Prahlerei gegeben, was für sie überflüssig war, während die Witwe diskret und bescheiden »alles gegeben [hat], was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt« (V. 44). Daher, so sagt Jesus, hat sie mehr gegeben als alle anderen. Aufgrund ihrer äußersten Armut hätte sie nur ein Geldstück als Opfergabe für den Tempel geben und das andere für sich behalten können. Doch sie will mit Gott nicht »halbe-halbe machen«: sie verzichtet auf alles. In ihrer Armut hat sie verstanden, dass sie alles hat, wenn sie Gott hat. Sie fühlt sich ganz von ihm geliebt und liebt ihn ihrerseits ganz. Was für ein schönes Vorbild, diese alte Frau!
Heute sagt Jesus auch uns, dass der Maßstab nicht die Menge, sondern die Fülle ist. Es besteht ein Unterschied zwischen Menge und Fülle. Du kannst viel Geld haben, aber leer sein: in deinem Herz ist keine Fülle. Denkt in dieser Woche über den Unterschied nach, der zwischen Menge und Fülle besteht. Das ist keine Frage der Geldbörse, sondern des Herzens. Es besteht ein Unterschied zwischen der Geldbörse und dem Herzen… Es gibt Herzkrankheiten, die das Herz zur Geldbörse herabwürdigen… Und das ist nicht in Ordnung! Gott »mit ganzem Herzen« lieben bedeutet, sich ihm anzuvertrauen, seiner Vorsehung, und ihm in den ärmsten Brüdern und Schwestern zu dienen, ohne irgendetwas als Gegenleistung zu erwarten.
Ich erlaube mir, euch eine Anekdote zu erzählen, zu der es in meinem vorigen Bistum gekommen ist. Eine Mutter war zu Tisch mit ihren drei Kindern. Der Vater war bei der Arbeit. Sie aßen Schnitzel… In dem Moment klopft es an die Tür, und eines der drei Kinder – sie waren klein, fünf, sechs Jahre, sieben das Größte – kommt und sagt: »Mama, da ist ein Bettler, der um etwas zu essen bittet.« Und die Mutter, eine gute Christin, fragt sie: »Was machen wir?« – »Geben wir ihm etwas, Mama…« – »In Ordnung!« Sie nimmt Messer und Gabel und schneidet von jedem Schnitzel die Hälfte ab. »Ach nein, Mama, nein! So nicht! Nimm etwas aus dem Kühlschrank!« – »Nein! Wir bereiten jetzt so drei Brötchen vor!« Und die Kinder haben gelernt, dass das wahre Werk der Nächstenliebe ein Geben ist, man tut es nicht mit dem, was übrig bleibt, sondern mit dem, was notwendig ist. Ich bin mir sicher, dass sie an jenem Nachmittag etwas Hunger gehabt haben… Aber so macht man das!
Angesichts der Bedürfnisse des Nächsten sind wir dazu aufgerufen, auf etwas zu verzichten – wie diese Kinder, auf die Hälfte des Schnitzels –, auf etwas Unverzichtbares, nicht nur auf etwas im Überfluss Vorhandenes. Wir sind dazu aufgerufen, die notwendige Zeit zu schenken, nicht nur die, die übrig bleibt. Wir sind dazu aufgerufen, sofort und vorbehaltlos etwas von unserem Talent zu geben, nicht nachdem wir es für unsere persönlichen Ziele oder die einer Gruppe genutzt haben.
Bitten wir den Herrn, dass er uns in die Schule dieser armen Witwe aufnimmt, die Jesus zum Erstaunen der Jünger auf den Lehrstuhl steigen lässt und als Lehrerin des lebendigen Evangeliums vorstellt. Durch die Fürsprache Marias, der armen Frau, die ihr ganzes Leben Gott für uns hingegeben hat, wollen wir um das Geschenk eines armen Herzens bitten, das jedoch reich an froher und unentgeltlicher Großherzigkeit ist.
_______
Quelle: Osservatore Romano 46/2015