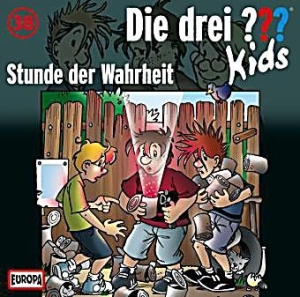Zur Klarstellung: Es handelt sich nicht um eine priesterliche Predigt, sondern um laienhafte Gedanken.
Der Weihnachtsfestkreis ist vollendet und der Osterfestkreis beginnt mit dem heutigen Sonntag Septuagesima, mit dem wir in die Vorfastenzeit eintreten.
Der Name „Septuagesima“ verweist uns auf ein historisches Ereignis zur Zeit des Alten Bundes, als das Gottesvolk zur Strafe für seine Untreue von Jerusalem verbannt, sich 70 Jahre lang in der Gefangenschaft in Babylon befand. Aber dieses historische Ereignis, von dem uns die Heilige Schrift berichtet, hat gemäß dem doppelten Schriftsinn auch eine tiefergehende geistige Bedeutung.
Wie das Volk Israel wegen seiner Untreue verbannt wurde, so geschah es schon mit unseren Stammeltern, die wegen ihres Ungehorsams aus dem Paradies verbannt wurden. Babylon ist ein Bild der Welt, die seit dem Sündenfall der Stammeltern des Menschengeschlechts sich unter der Gewalt des Teufels befindet. Gott ist als Schöpfer und Erlöser der Welt der rechtmäßige Herr derselben, doch Er ließ es zu, dass Satan und seine Anhängerschaft die Herrschaft an sich rissen. Unser Herr nannte den Teufel darum „Fürsten der Welt“ (Joh 12,31; 14,30; 16,11) und der Apostel Paulus bezeichnete ihn als Gott dieser Welt (2 Kor 4,4). Da wir uns zwangsweise in dieser Welt befinden, befinden wir uns in der Gefangenschaft Babylons, fern unseres himmlischen Vaterlandes, das durch Jerusalem symbolisiert wird.
Auf diese Wahrheit macht uns die heilige Kirche in der Vorfastenzeit aufmerksam. In der Liturgie wird ab heute das Alleluja unterdrückt und auch das Gloria verstummt. „Wenn wir unser Vaterland lieben, wenn unser Herz sich sehnt, dasselbe wiederzusehen, dann müssen wir mit all den Reizen brechen, welche die Fremde uns bietet, wir müssen den Becher zurückstoßen, mit welchem sie so viele unserer gefangenen Brüder berauscht. [...] Sie möchte uns bewegen, Sions Gesänge wenigstens in unheiligem Lande erschallen zu lassen, als ob unser Herz, fern von der Heimat, freudig bewegt sein könnte, da wir doch wissen, dass ewige Verbannung uns treffen würde; aber ‚wie sollten wir singen des Herrn Gesang im fremden Lande (Psalm 136)?‘“ (Dom Prosper Gueranger, Das liturgische Jahr). Beim heiligen Messopfer wird das Gottesvolk des Neuen Bundes nun nicht mehr mit den feierlichen Worte „Ite, Missa est.“ [Gehet hin, ihr seid entlassen.] entlassen, sondern es wird mit den Worten „Benedicamus Domino.“ [Lasset uns den Herrn preisen!] eingeladen, die Anbetung des barmherzigen Herrn, der uns trotz unserer Sünden nicht verwarf, im Stillen auch nach Ende der Messfeier fortzusetzen.
Wir werden dazu ermahnt, nicht dem Beispiel jener zu folgen, die „den Teufel zum Vater“ haben (vgl. Joh 8,44) und darum an dieser Welt hängen. Der Apostel Johannes schreibt: „Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist! Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt und ihre Begierde vergeht; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit“ (1 Joh 2,15-17). Und der Apostel Jakobus spricht eindringlich zu uns: „[…] wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes“ (Jak 4,4). Die Worte des Apostels Paulus aber sind gleichsam ein Programm für die vorösterliche Zeit, denn nachdem er uns davor gewarnt hat, uns „die Art dieser Welt zu eigen“ zu machen, fordert er uns dazu auf, uns umzuwandeln, „durch Erneuerung eures Denkens, um zu prüfen, was der Wille Gottes ist, was gut, wohlgefällig und vollkommen“ (Röm 12,2).
Bedenken wir, dass es keinen Mittelweg gibt. Der hl. Ignatius von Loyola belehrt uns in seinen Exerzitien über die zwei Banner, von denen „das eine von Christus, dem höchsten Befehlshaber und unserem Herrn; das andere von Luzifer, dem Todfeind unserer menschlichen Natur“ ist. Wir befinden uns notwendigerweise unter einem der beiden Banner. Wenn wir das eine wählen, so lehnen wir zugleich das andere damit ab und wenn wir das eine ablehnen, so wählen wir damit zugleich das andere. Darum spricht der Herr: „Wer nicht mit Mir ist, der ist gegen Mich“ (Mt 12,30). Alle, die also nicht auf der Seite Christi stehen, stehen notwendigerweise auf der Seite des Teufels, wenn auch nicht aktiv, so doch wenigstens passiv. Jede unrechtmäßige Willkürherrschaft stützt sich nicht zuletzt auf die träge Masse der Gleichgültigen. So kann auch der Satan seine Herrschaft in der Welt mit Hilfe dieser passiven Unterstützer verwirklichen und festigen und damit ungehindert Gott beleidigen und die Seelen verderben.
Darum wollen wir dem Christkönig in den Krieg folgen: Zur Ehre Gottes und zum Heil der Seelen! Durch Kampf wollen wir den Sieg, durch Sterben das Leben erringen. Die Vorfastenzeit ermahnt uns dazu, den Kampf, der aufgrund unserer Schwäche immer wieder schlaff und lau wird, mit neuem Eifer zu beginnen. Gerade angesichts der heutigen Umstände müssen wir im Weinberg des Herrn umso eifriger arbeiten.
Das Evangelium ermutigt uns, auf das Werben des Hausvaters, der niemand anderes als unser Vater im Himmel ist, einzugehen, und auf Seinem Weinberg, das ist die Kirche, zu arbeiten. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht nur die zum Klerikerstand Berufenen, sondern auch die, die im Laienstand leben durch Gebet und Opfer, durch Arbeit und Studium im Weinberg des Herrn zur Ehre Gottes und zum Heil der Seelen arbeiten dürfen und sollen. Der Lohn für jeden wird ein Denar, also die himmlische Glückseligkeit, sein. Dabei gibt es keinen Unterschied, ob einer sein ganzes Leben lang hart im Weinberg gearbeitet hat, ob er sich erst im Laufe seines Lebens oder gar erst kurz vor seinem Tode zu einem gottgefälligen Leben bekehren hat lassen. Entscheidend ist, in welcher Verfassung wir uns zum Zeitpunkt des Todes befinden, denn es steht geschrieben: „Ob ein Baum fällt nach Süden oder nach Norden, wohin der Baum fällt, da bleibt er liegen“ (Pred 11,2). Im Augenblick des Todes treten wir von der Zeit in die Ewigkeit ein und da die Ewigkeit naturgemäß keine Bewegung und daher auch keinen Wandel kennt, weil es ein „Vorher“ und „Nachher“ nur in der Zeit geben kann, darum werden auch wir nach dem zeitlichen Tode an unserer Verfassung nichts mehr verändern können.
Aber ist es nicht ungerecht – so könnte man fragen – dass diejenigen, die viel mehr gearbeitet haben, genauso viel bekommen, wie diejenigen, die viel weniger gearbeitet haben? Das bedeutet ja letztlich, dass die, die weniger gearbeitet haben, (im Verhältnis) mehr bekommen haben, als die, die mehr gearbeitet haben. Eine ähnliche, scheinbar ungerechte, Situation wird uns im Gleichnis vom verlorenen Sohn vor Augen geführt. Der eine Sohn, der seinem Vater stets treu gedient hat, hat vom Vater nie einen Ziegenbock bekommen, um mit seinen Freunden feiern zu können. Als dagegen der andere Sohn, der in die Welt hineinzog und sein ganzes Erbe verschleuderte, reumütig zurückkam mit den Worten: „Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen“ (Lk 15,21). da ließ der Vater das Mastkalb schlachten und seinetwegen ein Fest feiern. Als der treue Sohn darüber zornig wurde, sprach der Vater voller Güte zu ihm: „Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Man musste aber feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder war tot und lebt wieder, war verloren und wurde gefunden“ (Lk 15,31f.).
An den Worten des Vaters im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird schon deutlich, dass Gott nicht die Absicht hat, die Treuen hintanzusetzen und die Untreuen zu bevorzugen. Es geht vielmehr allein um die Freude über eine Bekehrung. Bei einer anderen Gelegenheit sagte Unser Herr, dass im Himmel größere Freude sein wird über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen (vgl. Lk 15,7). Die Freude des Himmels besteht nicht in der bisherigen Untreue, sondern darin, dass sich der bislang Untreue, der sein Leben – wie es im heutigen Evangelium heißt – „müßig“ verbrachte, nun auch endlich unter die Treuen einreihen und zusammen mit ihnen im Weinberg Gottes arbeiten wird. Von dieser Freude her versteht man auch den Willen des Hausvaters, dass diejenigen, die später zur Arbeit in den Weinberg kamen, zuerst ihren Lohn erhalten sollen und zum Schluss erst diejenigen, die von Anfang an im Weinberg arbeiteten. Dadurch, dass sich der Herr gegenüber denjenigen barmherzig zeigt, die erst später in den Weinberg kamen, werden diejenigen, die schon immer da waren, nicht ungerecht behandelt. Vielmehr werden die, die später kamen barmherzig behandelt. Die Barmherzigkeit aber ist nicht gegen die Gerechtigkeit gerichtet, sie ist nicht ungerecht. Während nämlich die Gerechtigkeit das gibt, was man verdient, gibt die Barmherzigkeit mehr als man verdient. Barmherzigkeit widerspricht also nicht der Gerechtigkeit, sondern sie übersteigt die Gerechtigkeit. Darum kann der Hausvater im Gleichnis auch sprechen: „Freund, ich tu dir kein Unrecht. Haben wir nicht einen Denar als Lohn vereinbart? Nimm also, was dein ist, und geh; ich will aber auch diesem Letzten geben wie dir. Oder darf ich nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge neidisch, weil ich gut bin?“
Es gibt also keinen Grund für den treuen Sohn gegen den barmherzigen Vater bzw. für diejenigen, die schon länger gearbeitet haben gegen den gütigen Hausherrn zu murren und neidisch auf den bislang untreuen Sohn bzw. auf diejenigen, die bislang nicht gearbeitet haben zu sein. Vielmehr dürfen auch sie mit dem Himmel jubeln und sich freuen, einmal darüber, dass sie so einen gütigen Gott haben und schließlich darüber, dass wieder eine Seele dem Feuer der Hölle entrissen wurde. Es ist ja ganz und gar widersinnig, wenn diejenigen, die lange Zeit in selbstloser Weise hart im Weinberg für die Rettung der Seelen arbeiten, sich dann darüber entrüsten, wenn sich eine Seele bekehrt und von Gott aufgenommen wird, wie sie auch selbst von Gott aufgenommen sind.
Wenn wir das Gleichnis in seiner Tiefe weiter durchforschen, so muss uns noch etwas Entscheidendes auffallen. Dieses Gleichnis ist eine Warnung der Getreuen Christi, eine Warnung vor dem Hochmut und der Herzenshärte, die unsere ganze Arbeit auf dem Weinberg Gottes verderben können. Wie sehr müssen sich doch diejenigen, die voller Eifer Tag und Nacht für die Kirche arbeiten, davor hüten, die Neubekehrten, die gerade noch große Sünder waren, gering zu schätzen und deren Wirken im Weinberg, als ob es im Vergleich zum eigenen Wirken nichtig wäre, zu verachten! Denn die, die neu hinzugekommen sind, haben bisher vielleicht schon viel mehr vollbracht als die, die immer schon im Weinberg waren. Denn die, die immer schon da waren, hatten gläubige Eltern und eine christliche Erziehung. Die aber, die neu hinzukamen, die mussten unter Umständen die schwersten Kämpfe durchmachen, um nun als Arbeiter im Weinberg Gottes tätig sein zu können. Sie murren nicht über die Entlohnung, sondern sie kämpften dafür, um Arbeiten zu können. Sie mussten sündige Gewohnheiten mühevoll ausreißen, mussten ihre Familie und Freunde zurücklassen, die ihren Weg zur Kirche nicht mitgehen wollten und vermutlich nun sogar gar nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Sie mussten die Kraft aufbringen, um einzusehen, dass ihr bisheriges Leben ein gewaltiger Irrweg war und nun noch einmal ganz von vorne beginnen. Und nun, da sie es mit der Gnade Gottes, endlich bis zum Weinberg geschafft haben, werden sie nicht freudig in Empfang genommen, sondern voller Verachtung ausgegrenzt. Nein, so etwas darf nicht sein! Wenn es aber so kommt, dann gelten die Worte des Herrn: „So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten; denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt.“ Und die, die von Anfang an berufen waren, werden in ihrer Verstocktheit und Herzenshärte die ewigen Feuerqualen erleiden müssen.
Aber auch aus einem anderen Grund kann es sein, dass gerade die, die später hinzugekommen sind, die alteingesessenen Arbeiter auf dem Weinberg übertreffen. Ein früheres Leben voller Sünde kann nämlich die Voraussetzung dafür sein, Unseren Herrn später umso inbrünstiger zu lieben. Eines Tages wurde der Heiland von einem Pharisäer namens Simon zum Essen eingeladen. Während des Mahles setzte sich eine stadtbekannte Sünderin – ihr Gesicht war von Tränen inniger Reue überströmt – zu Füßen des Herrn, die sie voller Liebe küsste. Weil aber das Herz des Pharisäers verhärtet und verstockt war, fragte der Herr ihn, welcher Schuldner seinen Gläubiger wohl mehr lieben wird, derjenige, dem fünfhundert Denare oder derjenige, dem fünfzig Denare erlassen werden. Als Simon richtig antwortete, dass derjenige ihn mehr lieben wird, dem er mehr erlassen hat, da sprach der Herr, auf die Sünderin verweisend: „Vergeben sind ihre vielen Sünden, denn sie hat viel geliebt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig“ (Lk 7,47). Von daher verstehen wir einmal mehr, warum der Herr die schlimmsten Sünder auf der Welt duldet. Wie sehr hat auch Paulus einst den Herrn gehasst und wie sehr hat er Ihn schließlich geliebt, sodass er sich nicht scheute, schwere Mühsal und große Leiden für Ihn zu erdulden! Auch in diesem Fall gelten die Worte Jesu, wonach die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein werden.
Dieses Gleichnis ist also alles andere als ein Angriff auf die treue Elite, sondern vielmehr eine heilsame Mahnung für sie, denn sie ist naturgemäß anfälliger für Hochmut und Herzenshärte als große Sünder, die sich bekehrt haben. Es ist freilich auch möglich, dass die Bekehrten mit der Zeit Teil jener treuen Elite werden, weshalb auch sie allmählich, ihre eigene Vergangenheit vergessend, in dieselbe Gefahr kommen können.
Der Denar – so haben wir festgestellt – ist die himmlische Glückseligkeit, denn er ist derselbe Lohn für alle Arbeiter auf dem Weinberg des Herrn. Alle werden im Himmel subjektiv vollkommen selig sein und nicht mehr begehren als sie haben. Objektiv dagegen wird es durchaus einen Unterschied im Grad der Seligkeit geben. „Denn“ – so schreibt Paulus – „wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten, und wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten“ (2 Kor 9,6). Auch im heutigen Gleichnis wird dieser objektive Unterschied deutlich, indem die einen, die weniger lang arbeiten genauso viel bekommen wie diejenigen, die länger gearbeitet haben. Im Verhältnis bekommen also die, die weniger lang gearbeitet haben, mehr als die, die länger gearbeitet haben. Und wenn wir uns erinnern, dass oft diejenigen, die später sich bekehren, eifriger arbeiten, weil sie durch eine innigere Liebe getrieben werden, dann sehen wir leicht ein, dass sie in der kurzen Zeit, die ihnen bleibt, mehr vollbringen, als die anderen in der langen Zeit. Sie bekommen darum mehr Lohn, weil sie auch mehr lieben. Freilich wird aber, wegen der subjektiv vollkommenen Glückseligkeit, niemand im Himmel murren und mehr begehren, vielmehr wird sich ein jeder über die Glückseligkeit des anderen von Herzen freuen. Die, die murren und sich mehr erhoffen, dass sind vielmehr wir hier auf Erden, insofern wir noch ein steinernes, statt ein barmherziges Herz haben.
Hören wir also auf den Herrn, der uns auffordert: „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!“ (Lk 6,36). Und der spricht: „Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden“ (Mt 5, 7). „Denn“ – so erklärt der Apostel Jakobus – „das Gericht ist erbarmungslos gegen den, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht“ (Jak 2,13).
Es gibt zwei Gefahren für uns. Die eine ist die, dass wir die Stärke und Festigkeit im alleinseligmachenden Glauben mit Härte gegenüber den anderen verwechseln und die andere ist die, dass wir die Barmherzigkeit und Güte zu den unsterblichen Seelen mit Erbärmlichkeit verwechseln und den Glauben verraten, um der Welt zu gefallen, womit keinem geholfen ist. Möge unser guter Herr uns vor beidem behüten!
Denjenigen, die die Sedisvakanz erkannt haben (ich eingeschlossen) scheint es oftmals an beidem zu gebrechen: an Stärke und an Güte. Anna Katharina Emmerick sah schon die heutige Zeit voraus und auch den Mangel an Stärke bei den letzten Treuen. Sie sah in einer Vision die Angriffe der Sekte auf die Kirche und in einer anderen Vision sah sie, wie die Restauration der Kirche vom Klerus und den treuen Gläubigen noch vor der Niederlage der Freimaurerei in die Wege geleitet werden würde, doch zunächst mit geringem Eifer. Diese Priester und Gläubigen erschienen ihr so, als würden sie weder Vertrauen noch Eifer noch Methode besitzen. Sie handelten, als wüßten sie überhaupt nicht, worum es ging, was sie sehr betrübte. (vgl. “La mission posthume de Sainte Jeanne d Arc” Msgr. Henri Delasses, 1913, Ed. Ste Jeanne d Arc, S. 502, 503) Der hl. Papst Gregor der Große aber prophezeite den Mangel an Güte: „Die Kirche wird in ihrer Endzeit ihrer Kraft beraubt werden. Für den Antichrist bereitet sich vor ein Heer von abgefallenen Priestern. Am Ende der Zeit wird es eine vollständige Vereinigung unter den Gottlosen geben, während es unter den Gerechten Trennungen und Spaltungen geben wird.“ (Dialogi, lib. IV.) Nutzen wir also nun die Vorfastenzeit, um uns neu zu besinnen und unter dem Banner des Christkönigs ebenso gütig wie stark zu kämpfen zur größeren Ehre Gottes und zum Heil der Seelen.
Christian Schenk