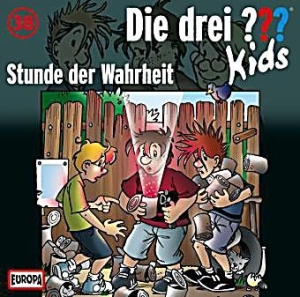VERTRAUENSVERLUST
Zu den folgenreichen Entwicklungen der sogen. kirchlichen Erneuerung in der Zeit nach dem Vatikanum II zählt die Erfahrung, daß sich das Erscheinungsbild der katholischen Kirche geradezu dramatisch verändert hat. Man könnte das schon an gewissen äußeren Aspekten bemerken; wir meinen es aber in Bezug auf ihre neue Selbstbewertung und die neue Bestimmung ihres Verhältnisses zur Welt und den anderen Religionen.
Diese Vorgänge und Entwicklungen sind von der nichtkatholischen und außer-christlichen Welt mit viel Lob und Zustimmung zur Kenntnis genommen worden. Aber auch innerhalb der Kirche selbst sind sehr viele mit der Entwicklung einverstanden und wollen sie unter allen Umständen weiterführen, weil sie meinen, hier sei das Rezept, das der Kirche wieder die Zustimmung der modernen Welt einbringen werde, die sich weithin dem kirchlichen und christlichen Glauben entfremdet hat. Diese Öffnung zur Weit ging einher mit einer Art Entrümpelung von vielem aus der ‘Urzeit’ stammenden Ansichten, Lehren und Praktiken, die, als typisch katholisch empfunden, als überflüssig, ja als schädlich und hinderlich für den Prozeß der Öffnung und Angleichung bewertet werden. Und Vorzeit ist alles, was vor dem Vatikanum II liegt.
Hinderlich ist vor allem, was dem Prozeß der ökumenischen Annäherung an den Protestantismus behindert, was bei den Protestanten auf Ablehnung stößt und deren antikatholischen Gefühle nähren und ‘rechtfertigen’ könnte, oder was den Widerspruch der ‘modernen Welt’ hervorrufen könnte. Der Wunsch, überall als Dialogpartner angenommen und ernstgenommen zu werden, wird auch auf die außerchristlichen Religionen ausgeweitet, mit denen man ebenfalls als mit Gleichwertigen und Gleichgestellten verkehrt, als Brüder im gleichen ‘Dienst an der Menschheit’ und dem Frieden.
Stark verlagert hat sich das offizielle Engagement der Kirche auf die sozialen und gesellschaftlichen Probleme, so daß man den Eindruck haben kann, es sei vor allem Anliegen der Kirche: der ‘Dienst an der Welt’, oder der ‘Kult des Menschen’, nach einem päpstlichen Wort.
Trotz des Lobes der außerkatholischen Welt über die “endlich erfolgte Öffnung” der katholischen Kirche durch die Liberalen, ist die katholische Kirche keineswegs an innerer Kraft erstarkt, sondern sie ist ganz offensichtlich an den Rand ihres inneren Zusammenbruchs geraten, wie fast von jederman bestätigt werden kann, der die Dinge zu sehen vermag. Der forcierte Prozeß der Angleichung an den “Geist der Zeit” ist zu einem Menetekel für die jetzige Garnitur der katholischen verantwortlichen Hierarchie geworden. Man zeigt die Betroffenheit über die Entwicklung nicht und überspielt sie mit allerlei frommen Rechtfertigungen, die nicht so recht zu denen passen wollen, die bereit sind, um der Zustimmung der modernen Welt willen, eigene doktrinäre Überlieferungen gewagter “Neuinterpretation” wegen preiszugeben, wenn nur das herauskommt, was erwünscht ist, vor allem aber der Beifall der liberalen Zeit.
EIN NEUER GEIST?
Weit geringere Aufmerksamkeit wird den Fragen des Glaubens im eigentlichen Sinne, dem Glaubensdogma zugewendet auf welchem Gebiet sich heute eine unübersehbare ‘Pluralität’ von Lehrmeinungen gebildet hat, die das bisher einheitliche Bild des katholischen Glaubens und der katholischen Kirche völlig verwischen und an die Stelle des einen Lehramtes der Kirche, das vor allem der Bewahrung und der Predigt der Offenbarung und der Tradition zu dienen hat, und in Person und Amt des Papstes gipfelt, eine Fülle von unfehlbaren Ersatzlehrämtern gesetzt hat, gegen die der Papst keine Chance mehr hat, gehört zu werden. Der Umgang des Papstes mit dogmatischen Fragen des Glaubens selbst ist von einer Fahrlässigkeit, die einen die Haare zu Berge stehen läßt. Man merkt, daß solche Dinge ihn nicht weiter interessieren; er sieht hier offenbar keine Probleme, und es macht ihm nichts aus, sich mit den nichtchristlichen, heidnischen Religionsdienern zu gemeinsamen ‘Gottesdiensten’ zu begeben, von jüdischen und protestantischen Kulten einmal ganz zu schweigen. Man vergegenwärtige sich nur die skandalösen Vorgänge in Assisi und anderswo. Es macht ihm nichts aus, heidnische Rituale selbst zu vollziehen, (um seine Gastgeber nicht zu kränken?). Es macht ihm nichts aus, theologisch und dogmatisch höchst bedenkliche Aussagen zu machen, etwa vor Muslimen daß wir doch “alle den gleichen Gott haben”. Gewiß, die Liberalen jubeln.
Aber wen wunderts, daß solches Verhalten des ‘Stellvertreters Christi’ auf mehr denn auf Verwunderung stößt, bei vielen Katholiken auf Empörung und auf Ablehnung. Aber dabei bleibt es nicht; mit der Frage nach dem verwunderlichen und anstößigen Verhalten erhebt sich die Frage nach den Zielen und Absichten des Kurses in der nachkonziliaren, in der sogen. erneuerten Kirche. Der Papst ist es ja nicht allein, dessen Verhalten nachdenklich macht und zu fragen nötigt, wohin denn wohl der Trend dieser Erneuerung gehen soll, wohin die Gläubigen geführt werden sollen.
Vertreter und Befürworter des konziliaren Kurses der neuen Kirche sitzen in allen hierarchischen Rängen und vor allem bei den Vertretern der Theologie als Wissenschaft, die sich nicht länger den Vorwurf der Modernen und Atheisten anhören wollten, sie verträten mittelalterliche Ansichten in einer modernen Welt, die sich anschicke, den Weltraum zu erobern. Es stecke in ihnen die Angst, die Kirche könne das Jahr 2000 nicht mehr lebend erreichen, wenn sie sich nicht endlich entschieden dem ‘Geist der modernen Welt’ öffne, ihn übernehme und in seinem Licht ihre Vergangenheit, ihre Lehre und Praxis neu ‘interpretiere’ und diesem modernen Geist anpasse.
In der Praxis bedeutete das eine weitgehende Revision in der Lehre und der Praxis der Kirche, die einer Kulturrevolution gleichkommt. Was von oben als Erneuerungsprogramm verkündet wurde, wird auf den mittleren und unteren Rängen zu einem Ausverkauf katholischer Tradition benutzt.
Man versucht zwar heute, manches von dem damals Zerschlagenen und Aufgegebenen wieder zu beleben. Aber was abgetrennt ist, kann man nicht einfach wieder ansetzen, zumal die geistigen Voraussetzungen sich gewandelt haben.
WIRKUNGEN
Die Öffnung und Erneuerung hat eine zweifache Wirkung gehabt. – Zum einen hat sie eine große Zahl von liberal denkenden Katholiken aus der Kirche hinausgeleitet. Ihnen lieferten die als liberal empfundenen und begrüßten Reformen den willkommenen Vorwand, mit gutem Gewissen eigene religiöse Wege zu gehen. Man hörte und hört oft die Wendung: Es ist doch jetzt gottseidank alles nicht mehr so streng, man braucht nicht mehr so arg katholisch zu sein, und wir sind ja auch nicht anders als die anderen! Oder wie die Formeln alle heißen. In diesen Kreisen wurde das Neue freudig begrüßt, man fühlte sich von einer Last befreit, die man schon lange als zu schwer empfunden hatte. Diese Katholiken werden in der Kirche nicht mehr gesehen, und sie haben verständlicherweise kein Interesse an einer Änderung, an einer ‘Rückkehr; sie werden die Reformen verteidigen, obwohl sie und weil sie sich in praxi von der Kirche verabschiedet haben. Und so sind in der Tat sehr oft die größten Applaudierer dieser Reformen unter den Liberalen zu finden. Eine nicht unbedeutende Rolle spielt bei diesen der Gedanke, daß eben jeder nach “seiner Fawn” sich seine Religion wähle, oder die Art, wie er seine Religion nehmen wolle, wie er sich “seinen Gott” denken wolle. Niemand habe ihm da Vorschriften zu machen. Diese Art von sogen. Religionsfreiheit wird als eine besonders wichtige Errungenschaft des letzten Konzils in der Praxis betrachtet. Es meint eigentlich nicht die rein bürgerliche Freiheit, sich frei von staatlichem und gesellschaftlichem Zwang eine Religion zu wählen und sie auszuüben, ein Gedanke, der zu bejahen ist. Es meint vielmehr den Gedanken, daß der Mensch sich, unter Zustimmung Gottes, eine Religion wähle, und diese zur Grundlage seines Heiles werde. Die Kirche habe nicht das Recht zu erklären, daß vor Gott niemand „das Recht” habe, gegen den Anspruch der göttlichen Offenbarung auf einem anderen Heilsweg zu beharren, sofern ihn nicht ein unverschuldet irrendes Gewissen bindet. Diese sogen. ‘innere’ Religionsfreiheit wird meist mit der ‘äußeren’ Religionsfreiheit verwechselt, die an sich unproblematisch ist. Vor der Offenbarung kann es keine legitime Berufung auf einen anderen Heilsweg geben; der Irrtum besitzt nicht die gleichen Rechte wie die Wahrheit. Für wen es freilich in der Religion keine Wahrheit gibt, für den gibt es auch keine Verpflichtung des Menschen, die Offenbarung Christi anzunehmen, wenn sie erkannt wird. Und deshalb auch keinen kirchlichen Anspruch, besser: keine Pflicht der Kirche, diese verbindliche Offenbarung Christi als einzigen Heilsweg allen Menschen zu predigen und sie für Christus zu gewinnen, weil ihr ewiges Heil davon abhängt. Für einen Modernen hängt sein Heil einzig davon ab, ob er seine Wahl “aufrichtig” getroffen hat, nicht an einer “Wahrheit”, der man sich fügen müsse. Denn “Wahrheit” macht jeder selbst, indem er eine Wahl trifft.
Wer sich die Mühe macht, genau hinzuhören, der wird leicht feststellen, daß sich auf diesen Ebenen der Lehre der Kirche Erhebliches verschoben hat. Es gehört fast zum selbstverständlichen Grundgefühl solcher modernen Katholiken, daß dieser Anspruch der Kirche nicht mehr gerechtfertigt ist und nicht länger aufrechterhalten werden darf, und zwar, weil er eine Beleidigung der anderen Christen und Religionen darstellt und eine Minderbewertung ihrer Überzeugung. Er stelle eine ungerechtfertigte, und angesichts der ‘Fehler und Verbrechen’ der Papstkirche ohnehin fragwürdige Behauptung dar, ein Anspruch, der dem neuesten Erkenntnisstand ökumenischer Forschung, und dem ‘unbedingten Einheitswillen’ nicht mehr entspricht. Man kann in der Tat nicht energisch in Theorie und Praxis Ökumene betreiben und gleichzeitig den Wahrheits- und Rechtfertigungsanspruch der bisherigen katholischen Kirche vertreten. Beides schließt sich nun wirklich aus. Die Betrachtungsebene ist hier von einer inhaltlichen Sicht, einer objektiv und vorgegebenen Inhaltlichkeit, auf eine rein äußere, “praktische”, manipulierbare Ebene verlagert.
Es gilt auch hier, daß man bei solchen Dingen nicht auf die offiziellen Verlautbarungen von oben achten sollte, sondern auf das, was sich unten tut. Wer nur die offizielle Seite sieht und nicht die Bewußtseinsveränderungen in den Menschen, der wird uns wohl kaum zustimmen. Aber irgendwoher müssen es auch die ‘Kleinen’ haben, die unten, an ihrem beschränkteren Wirkungsbereich solche Wirkungen auslösen. Denn der gute Wille der gläubigen Menschen ist vorhanden: es muß also an dem liegen, was sie zu hören bekommen, und das erfährt man nur durch genaues Hinhören.
DIE UNERWÜNSCHTEN
Und dann haben die Reformen eine Gruppe von Katholiken getroffen, die zu den treuesten Kindern der Kirche zählten: die gläubigen und die frommen, die bewußten Katholiken, Priester und Laien. die mit besonderer Liebe an der Kirche hingen und für sie den letzten Einsatz zu geben bereit waren. Nicht daß es sich hier um Menschen gehandelt hätte, die religiös ‘versorgt’ werden wollten, wie man das ihnen stets unterstellt. Sie sind im Gegenteil Gläubige, die ihren Katechismus genau kennen und die wissen, warum sie katholisch sind. Die Vorstellung, diesen Glauben ‘leichter’ oder ‘moderner’ zu machen. ist ihnen ein absurder Gedanke, der ihnen die Oberflächlichkeit dieses Denkens verrät So wenig man die Liebe zu einem Menschen ‘leichter’ machen kann. so wenig ist die Beziehung des Glaubens zwischen Christus und dem glaubenden Menschen etwas, das mit solchen Kategorien erfaßt werden kann.
Denn dieses „leichter”, wie es ‘unten’ empfunden wird, ist ein ‘weniger’ in jeder Hinsicht, und es ist ein ‘anders als bisher’, wobei man das Neue und das Alte in vielen Fällen nicht mehr miteinander verbinden kann, so daß man sich irgendwann entscheiden muß, was man will! Wer darauf nicht achtet, wird mit Sicherheit irgendwann einmal Schaden an seinem katholischen Glauben nehmen. Ohne Unterstellung böser Absicht ist zu sagen: es ist ein Hauptziel der Reformer, dem katholischen Glauben ein neues, modernes Gesicht zu geben. ein Glaube, der in Übereinstimmung stehen soll mit den leitenden Ideen der jeweiligen Zeit. Diese der Glaubenstradition nach ihren Inhalten und ihrem Geist verbundenen Katholiken machten mit einem Male eine merkwürdige Erfahrung: sie waren über Nacht zu unerwünschten Personen geworden in der Kirche. Auf ihre Fragen, Sorgen und Proteste hin wurde ihnen bedeutet, daß sie den ‘Anschluß’ versäumt hätten und daß ihre Zeit nun vorüber sei. Je nach dem Grad der Höflichkeit, den man bereit war, ihnen gegenüber noch aufzubringen, wurde das mehr oder weniger deutlich zum Ausdruck gebracht. Noch vor kurzem hatten sie sich in der Kirche engagiert, und nun waren sie kurzerhand an den Rand gedrängt. Was sie noch vor kurzem als den Ausdruck des kirchlichen Glaubens angesehen hatten, das wurde nun stark bezweifelt und wurde in wilden Diskussionen zerredet und durch Neuheiten ersetzt, deren Inhalt nur noch den gleichen Namen hatte.
So wurde eine Atmosphäre geschaffen, die jedem gläubigen Katholiken ein Gefühl der Rückständigkeit suggerierte, wenn er sich gegen die Neuerungen wandte, und wenn er weiterhin nach Art ‘der Väter’ glauben wollte. Die Liberalen und diejenigen, die nicht so sehr auf die Inhalte, sondern mehr auf die moderne Form achten, triumphieren, die andern sind abgedrängt ins Schweigen oder ins Abseits, von wo viele auf der Suche nach der Kirche ihrer innersten Überzeugung zu den traditionalistischen Gruppen und Bewegungen stoßen. Was aber besonders schmerzhaft ist für diese Gläubigen, das ist die Empfindung des Preisgegebenseins durch die Hirten und der Verlust an Vertrauensbereitschaft gegenüber den Hirten der Kirche, das von niemand härter empfunden wird, als von diesen Gläubigen selbst.
Ein Katholik hat gelernt, wo der Papst, wo der Bischof, da ist die Kirche! Wie war es anders zu erwarten, als daß die gläubigen Katholiken ihr Vertrauen und ihre Bereitschaft zum Gehorsam auch auf die neuen Ordnungen und die Reformen übertragen haben. Und dann machten sie solche Erfahrungen! Kann man es ihnen verdenken, wenn sie nachzudenken begannen, wohin sie denn eigentlich geführt werden sollten, als man begann, das ihnen vertraute Bild des katholischen Glaubens, besonders die Gestalt der Heiligen Messe, energisch zu verändern, als sich alle diese Erfahrungen einstellten? Wie soll sich Vertrauen aufbauen, wenn die Frage sich stellt: Wohin werden wir geführt? Gewiß, die oberen Hirten erklären bei jeder Gelegenheit: nichts hat sich geändert! Aber die praktische Erfahrung ist eben eine ganz andere! Allein die an die geistige und geistliche Substanz gehende Veränderung der hl. Messe war ein Bruch, den zahlreiche Katholiken als das schmerzlichste und weitreichendste Signal des neuen Geistes empfanden. Im Ergebnis hat die Kirche einen immensen Verlust erlitten, den viele immer noch nicht bereit sind zuzugeben. Rein menschlich gesehen erachten wir den Zustand der gegenwärtigen Kirche in unseren Breiten für hoffnungslos, wenn man die inneren Verluste an gläubiger Substanz in Rechnung stellt, für die es keine Statistiken gibt, die man aber erfährt im Umgang mit Menschen und mit Jugendlichen.
Kein Geringerer als Karl Lehmann, Bischof von Mainz und prominentester Vertreter der Neuerungen, hat Ähnliches ausgesprochen, wenn auch in anderem Sinne. In einer Rede vor Pfarrgemeinderäten sagte er, die Kirche habe in den letzten zwanzig Jahren, wo sich “draußen (vor den Toren der Kirche) viel verändert hat”, “unglaublich viel Terrain verloren”. Über die Ursachen dieses Verlustes sagt er, das sei geschehen, weil sich die Kirche in der Vergangenheit “eingeigelt und die elementaren Bewährungsfelder des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe preisgegeben habe”. Jetzt gelte es, in allen gesellschaftlichen Feldern wieder “offensiver” zu werden.
Diese Äußerung ist mehr als aufschlußreich. Sie gibt genau das Standardargument der Progressiven wieder:
Wären wir nicht gekommen, so wäre alles noch viel schlimmer geworden! Indessen ist diese Schuldzuweisung auch nicht durch übergroße Voreingenommenheit für die eigene Position zu entschuldigen; sie ist menschlich und sachlich unerträglich.
Es wird zwar der allgemeine Niedergang des Glaubens gesehen, — der in den Jahren seit der unbehinderten Umgestaltung des kirchlichen Lebens in den konziliaren Reformen eingetreten ist; er darf aber nach der gültigen Denkregelung nicht mit diesen in Verbindung gebracht werden. Vielmehr nimmt man den Anlaß wahr, nur umso mehr die Notwendigkeit der Reformen zu verteidigen.
DIE SCHULD VON GESTERN?
Wir fragen uns, was müssen die Priester und Laien, die noch aus jenen ‘eingeigelten’ Jahren stammen, zu diesen Feststellungen sagen? Wir haben hier den Grund, warum man sie ausschaltet, wo es nur geht.
Spontan würde man sagen, daß unter der heutigen Erfahrung jene vorkonziliare Kirche geradezu üppig blühend gewesen war trotz ihrer zuzugebenden Mängel.
Die Katholiken aus jenen dunklen vorkonziliaren Zeiten könnten dem Bischof vielleicht sagen, daß er froh sein könnte, wenn seine heutige, erneuerte Kirche ebenso voll und bekenntnisfreudig wäre, wie jene; er könnte froh sein, ebensoviel geistlichen Nachwuchs zu haben, wie in jenen Zeiten; er könnte froh sein, wenn die Gläubigen ebenso eifrig die Stimme der Kirche hörten, wie damals, als noch ein Pius XII. oder andere bedeutende Hirten ein hohes Maß an Achtung und Respektierung der Kirche erreichten.
Was werden jene Katholiken sagen, die in den unseligen Jahren des Nationalsozialismus unter größten Gefahren der Kirche und dem Glauben die Treue hielten und für sie arbeiteten, Seelsorge und Jugendarbeit nur um den Preis der vollen Nichtangepaßtheit an das “Neue Deutschland” und die neuen gesellschaftlichen Felder zu machen war? Welche Bekenntnistreue konnte man damals sehen? Was wäre, der Gedanke verwirrt einen, wenn es heute in der angeblich erneuerten Kirche und ihrem erneuerten Glauben wieder eine Situation gäbe, in der man unter Gefahr für die physische und gesellschaftliche Existenz Zeugnis geben müßte für den gekreuzigten Christus und seine Kirche? Ob dann die an Pluralität und Anpassung gewöhnten, ökumenisierten und an weltanschauliche Toleranz geübten Christen ebenso konsequent ihre Entscheidung zu treffen büßten? Oder werden sie, da ihre bevorzugten „Bewährungsfelder” der Einsatz für die ‘weltliche Welt’ und ihren sozialen Fortschritt ist, keine ‘Eingeigelten’ sein wollen? Gebe Gott, daß uns die Probe erspart bleibt. Es ist seltsam, daß ein gelehrter Mann zu solch pauschalen und verletzenden Urteilen kommt. Was rät er nun? Seine Antwort ist wiederum eigenartig. Er rät nicht, die theologischen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, die eine individuelle Bekehrung erfordern, neu zu beleben, sondern er rät, offensiver an die gesellschaftlichen Bewährungsfelder heranzugehen. Das liegt genau im Trend der Verlagerung des kirchlichen Hauptaugenmerks: in allen gesellschaftlichen und sozialen Problemen der Zeit mitzureden. Was die Kirche durch die Aktivitäten und die Wirkung des umtriebigen Papstes gewonnen haben mag, das ist auf der Gegenseite mehrfach wieder verloren gegangen. Und im übrigen ist der Beifall, den der Papst auslöst, uns nicht ganz unverdächtig. Wenn er einmal etwas fordert, was über die allgemeinen Feststellungen hinausgeht, oder die allgemeinen Erwartungen, die jeder hat, wenn er Forderungen stellt, die unmodern oder zu katholisch erscheinen, dann sind flugs flinke Geister zur Stelle und mächtige Bischofskonferenzen, die das Ganze in den rechten ‘Horizont’ stellen, und alles ist wieder wie man es haben will. Und der Papst fügt sich. Es hat den Anschein, daß die Autorität des Papstes nicht mehr reicht, seinen Willen durchzusetzen. Auch das ist ein Ergebnis der konziliaren Reformen. Wer ist eigentlich ‘maßgeblich’, wessen ‘Lehramt’ ist verbindlich, wo ist das, was alles im Gewissen binden kann? Man braucht sich nicht zu wundern, wenn jeder das nach seiner Weise tut, warum nicht auch die ‘traditionalistischen Katholiken’, die mindestens den Vorzug haben, nicht ihrer Willkür, sondern der großen Glaubenstradition der Kirche zu folgen.
Nun ist das stärkere Engagement des Papstes und der Kirche in den Fragen von sozialer Ordnung und moralischen Problemen an sich nicht zu verurteilen. Es wird viel Gutes und Richtiges dazu gesagt. Darüber geht auch nicht unser Bedenken. Unser Erfahrungsfeld ist mehr von der kirchlichen ‘Basis’ geprägt, wo die hehren Gedanken der Erneuerung in die praktische Wirklichkeit umgesetzt werden, und wo sich Praktiken und Lehren etabliert haben, die, wenn sie tatsächlich den Geist der Erneuerung widerspiegeln, einen neuen und anderen Glauben darstellen als den, den der gläubige Katholik bisher verkündet bekam. Das mag für viele unverständlich und übertrieben klingen. Es kommt ganz auf den eigenen Erfahr Erfahrungsstand an. Man suche nicht so sehr spektakuläre Aktionen, man achte auf die kleinen Einzelheiten. Nicht wenige machen immer wieder ähnliche Erfahrungen. Da treffen sich nach vielen Jahren wieder gute Freunde von einst, damals “kernkatholische” Christen. Priester wie Laien. Kommt man ins Gespräch, so offenbaren mitunter die einst so “urkatholischen” Leute Ansichten, die einen einen Schauer einflößen, angesichts der Unterschiede damals zu heute. Und den Leuten erscheint das alles normal, daß eigentlich Unvereinbares geschieht. Man hat sich daran gewöhnt.
OBEN UND UNTEN
Es kann geschehen, daß es dennoch bewußt wird und dann Ratlosigkeit auslöst. Da wird selbstverständlich nichtkatholischen Christen die Eucharistie gereicht, nicht einmal, sondern ständig. Da ist eine Gruppe von katholischen Theologiestudierenden, die sich zu einem Wochenendseminar trifft. Am Sonntag besucht man den Gottesdienst und weil keine katholische Kirche am Ort ist, geht man in die protestantische und nimmt dort auch selbstverständlich am Abendmahl teil. Zur Rede gestellt, äußern sie nur grenzenloses Erstaunen über den Sinn der Frage:- Wieso, die tun doch genau das Gleiche wie wir. Da werden offensichtlich sowohl gültige Regeln zum Sakramentenempfang und ihrer Spendung mißachtet, als auch kirchenrechtliche Ordnungen, etwa was den Sakramentenempfang geschiedener Wiederverheirateter betrifft, und das alles in größter Selbstverständlichkeit. Davon, daß es dogmatische, also lehrmäßige Aussagen gibt, die gewisse Dinge nicht erlauben, weiß man offenbar dort unten nichts mehr, und wenn, betrachtet man sie als lästige Bevormundung. Meistens hört man dann: Was wollen Sie denn? Wir haben das so gelernt; was Sie sagen, haben wir noch nie gehört! Sie meinen also, katholisch zu handeln, wo sie den katholischen Glauben längst hinter sich gelassen haben. Wer ist dafür verantwortlich? Und für diesen Glauben haben die kleinen Päpste und Kirchenlehrer unten bei den Maßgeblichen oben die besten Vorbilder. So hört man von der Priesterweihe an Max Thurian, einem der Gründer der evangelischen Gemeinschaft von Taizé, ohne daß er den katholischen Glauben angenommen habe. Dem italienischen Kardinal, der die Weihe gespendet haben soll, mag das nicht als wünschenswert erschienen sein. Man darf auch voraussetzen, daß dem Papst davon bekannt war, und daß er die Aktion guthieß. Was den Großen gutdünkt, was soll es die Kleinen hindern? Und setzt sich nicht der Papst bei vielen Gelegenheiten zu gemeinsamen Kulthandlungen mit Vertretern der verschiedensten Religionen zusammen: haben wir nicht ‘alle den gleichen Gott?’ – Wie soll man unten noch unterscheiden, was man meiden sollte und was nicht, wenn es oben vorgemacht wird? Was sich hier auswirkt, sind die gewichtigsten Grundsätze des letzten Konzils, allen voran der Ökumenismus, der zu einer tödlichen Gefahr geworden ist. Die liberalen Reformen haben bei Priestern und Laien das Wissen und Bewußtsein um den Wert des eigenen Glaubens weitgehend schwinden lassen, wenn wir dieses Urteil auch keineswegs pauschal verstanden wissen wollen. Aber wenn Sie wirklich wissen wollen, was neue Kirche und was neuer Glaube ist, dann müssen Sie nach unten schauen, auf die stille Praxis, nicht nach oben, wo alles schön abgeklärt klingt. Was bedeutet es schon, wenn ein Kardinal erklärt, Interkommunion sei “noch nicht möglich”? Unten wird das schon längst ohne Lärmentwicklung geübt. Und so geht es in vielen Dingen, die meisten sind so unspektakulär, daß sie gar nicht wahrgenommen werden. Es geschieht “Wandel durch Umgewöhnung”, nun “Wandel durch Abschleifung”.
Es mangelt ja nicht am guten Willen der Katholiken, es mangelt an den Hirten und an dem, was sie den Gläubigen als “katholischen Glauben” verkünden.
REFORMEN SIND NÖTIG
Wir gehören nicht zu denen, die die vorkonziliare Kirche als fehlerfrei betrachten. Ganz gewiß ist die Kirche aufgerufen, die Menschen der jeweiligen Zeit auf die ihnen gemäße Weise anzusprechen. Wir sind nicht gegen Öffnungen und den Abbau überkommener Gepflogenheiten, wenn sie die Glaubensverkündigung behindern. Wir sind nicht einmal gegen Reformen im rechten Sinne, auch wenn sie weitgehend sind. Wir wissen, es geht nicht um den Streit zwischen ‘alt’ oder ‘neu’. Es geht um wahr oder falsch! Aber wenn diese Frage nicht mehr gestellt werden darf, dann kommt Mißtrauen auf. Es geht darum, der Kirche unter Wahrung ihrer unverwechselbaren Identität in Lehre und Anspruch die größtmögliche Glaubwürdigkeit zu geben in der Verkündigung ihrer übernatürlichen Botschaft der Offenbarung. Wenn die Kirche nicht mehr unverwechselbar erkennbar ist, wenn sie sich in die ‘Pluralität der Kirchen’ begibt, dann hat sie ihren Anspruch preisgegeben, sie mag so ‘gesellschaftlich offensiv’ sein. wie sie nur will.
Wir wollen keineswegs für alle Erscheinungen des Verlustes oder des Niedergangs die jetzige Kirchenpraxis verantwortlich machen. Das wäre ungerecht. Sehr vieles ist dem Einfluß einer äußerst religions- und christentumsfeindlichen liberalen Grundideologie unserer modernen Gesellschaft zuzuschreiben. Aber die liberalen Reformen des letzten Konzils, oder das, was ihm zugeschrieben wird, haben diesem Geist innerhalb der Kirche alle Tore geöffnet. und sie haben versäumt, Gegenmittel dagegen zu bereiten. Meinten sie doch, durch weitgehende Rezeption der Prinzipien dieses modernen Geistes, seine kirchenfeindliche Wirkung abfangen zu können. Diese Einschätzung war falsch. Das Konzil hat nicht nur den Feind ins Innere des Heiligtums geladen, es hat ihm auch freie Hand gegeben, seine Wirkung im Namen des Glaubens zu tun, indem aller Gehorsam dafür gefordert wird. Das muß umgekehrt werden!
Wir behaupten nicht, die Kirche sei vom Glauben abgefallen. Aber wir sehen, wie innerhalb der Kirche ein den Glaubensabfall vieler Katholiken fördernder Prozeß der Preisgabe unabdingbarer katholischer Positionen am Werke ist, um der ökumenischen Fortschritte willen; wie der Gesichtsverlust der katholischen Kirche voranschreitet, der auch nicht durch noch so viele Weltreisen des Papstes, oder durch gesellschaftliche Engagements wettgemacht werden kann, weil er ein Ergebnis einer geistlichen, innerlichen Macht ist, und nicht Ergebnis klugen Managements. Und wir sehen, wie der praktische und gelebte Glaube sich verdünnt bei den Gläubigen, die ungeschützt diesen Reformen ausgesetzt sind.
Wir wissen um die bedenklichen Mängel und verhängnisvollen Fehleinstellungen der sogen. vorkonziliaren Kirche, trotz all ihrer im Vergleich zu heute blühenden Lebendigkeit. Wir sind uns im klaren, daß eine die moderne Zeit verstehende seelsorgerliche Aufgeschlossenheit und Anpassung unvermeidlich ist und wäre. Wir wären sogar in der Lage, sehr viele von den modernen, auf die Verlebendigung der kirchlichen Botschaft zielenden Anstöße mitzutragen, wenn sie nicht eingebettet wären in eine inakzeptable Absicht progressiver Neulehre, die sich nicht begnügt, neue Methoden zu finden, oder Fehler abzustellen, sondern die darauf beruht, eine neue Lehre, ein neues Selbstverständnis der Kirche zu etablieren. Dieser Weg führt letztlich zum Ruin der Kirche, d.h. des überkommenen Glaubensverständnisses, des traditionellen Dogmas. Und dieser Weg ist ungangbar!
IM LICHT DER TRADITION
Solange also nicht die Reformen und Neuerungen verbindlich “im Licht der Tradition” gedeutet und verstanden werden. solange nicht eindeutig ihre Einbindung unter die Autorität der dogmatischen Tradition gewährleistet ist, solange das berechtigte Mißtrauen gegen den Weg der Neuerungen besteht, solange kann kein Katholik verpflichtet werden, in diesen Neuerungen den Heiligen Geist am Werke zu sehen. Vertrauen kann nicht befohlen werden durch Berufung auf die Autorität, es muß sich erweisen durch Glaubwürdigkeit, und diese muß erst in großem Maß wieder zurückgewonnen werden, dadurch, daß der gläubige Katholik wieder die unbedingte Gewißheit haben kann, durch Einsatz seines Glaubensgehorsams nicht seinem angestammten Glauben entfremdet und in einen ökumenisierten Neuglauben geführt zu werden. Der Entscheid zum Glauben, diesem oder jenem, katholisch oder reformatorisch, darf dem einzelnen Christen nicht durch gemanagte Einheitsprozesse abgenommen werden, die ihn nicht erkennen lassen, wohin der Weg geht. Um seines Gewissens willen darf ihm das nicht vorenthalten werden. Wir sind für unbedingte Toleranz mit den Christen aller Bekenntnisse, für die Achtung ihres Glaubenszeugnisses, aber auch dafür, daß die Wahrheitsfrage niemand vorenthalten werden darf, weil sie zur Würde des Menschen gehört und weil Christus sie will, der selbst “die Wahrheit ist”.
(Beda-Brief Nr. 277/278-1988)
Veröffentlicht in „Das Zeichen Mariens, September 1988, Seiten 6934-6938