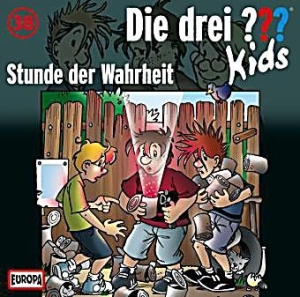Die Trennung der Kirchen ist der größte öffentliche Skandal der Christenheit, sie ist durch nichts zu entschuldigen, auch nicht in ihren Ursachen oder in ihren Folgen, nämlich die Unglaubhaftigkeit der christlichen innern und äußern Mission; alles, was hilft, sie rückgängig zu machen, liegt von vornherein in der Sinnrichtung des Heilswillens Gottes. Daß überhaupt der Gedanke Macht gewinnen konnte, in dieser Angelegenheit sei etwas zu machen, älteste, hoffnungslose Vereisungen seien trotz allem aufzuschmelzen: das läßt sich anders nicht verstehen als durch ein Gnadenwunder des göttlichen Geistes, der in seiner Freiheit doch auch die Gebete und Schmerzen der Christen hüben und drüben gehört hat.
Tun wir alles, was in unserer Macht steht, indem wir nichts uns selber zuschreiben, alles aber dem allmächtigen Schöpfergeist. Und da wir so zu hoffen begonnen haben, leisten wir weiterhin die Vorgabe der Hoffnung, gegen alle Rückschläge, alle noch so offenkundigen Unmöglichkeiten. Nur der Geist Christi kann solche Trennungsmauern niederlegen, nicht wir mit all unserem besten Willen, mit all unserer klugen theologischen Diplomatie. Es wird gut sein, wenn wir gerade hier mit erhöhtem Mißtrauen auf die verborgenen Zweideutigkeiten unserer Unternehmungen achten und diese stetsfort unter die Krisis des Gotteswortes stellen. Ist doch die Forderung nicht leicht erfüllbar: alles in unserer Macht Stehende selber zu versuchen, was den Einheitsgeist Christi fördert, und dabei nichts zu tun, was auf rein menschliche Weise diesem Geist «technisch», «magisch» zwingend zuvorkommen würde.
Es wäre so naheliegend zu sagen: Betonen wir doch das Einigende, und lassen wir das Trennende in den Hintergrund treten. Das möchte bei den Evangelischen eher hingehn, wo das Trennende mehr in einem Minus besteht als in einem Plus, das uns Katholiken als unausgewiesener Überschuß über die schlichte Botschaft des Evangeliums angekreidet wird. Für die Evangelischen ist die Schwierigkeit die, zu verstehen, daß dieses katholische Plus durchsichtig gemacht werden kann auf das Evangelium. Somit wäre die Pflicht der Katholiken, diese mögliche Durchsichtigkeit und dann faktische Durchsicht zu erwirken. Aber wie? Man kann mit Recht sagen, alle kirchlichen Dinge, auch die dogmatischen Sätze seien relativ, nämlich bezogen auf den Absolutpunkt der Offenbarung Gottes in Christus. Der Leib ist relativ auf das Haupt; die Eucharistie ist relativ auf das Abendmahl und das Kreuz; die Mutter ist relativ auf den Sohn, das Fegfeuer ist relativ auf Christi Gericht, das kirchliche Amt ist erst recht relativ auf das Priestertum Christi, und für die Amtsträger gilt nicht weniger als für die übrigen: «Einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder.» Und jedes Dogma ist relativ auf die Offenbarungswahrheit, die es umschreibend, zusammenraffend, gültig, aber nicht erschöpfend darstellen will. Diese richtige Relativität wird am besten existentiell vor den getrennten Glaubensbrüdern erwiesen, wie etwa Johannes XXIII. die Relativität auch des obersten Kirchenamtes eindrucksvoll der ganzen Welt vorgelebt hat. Oder wie jedes Konzil die richtige Relativität eines Dogmas dadurch herausstellt, daß es dieses, ohne es zu gefährden, in neue Zusammenhänge rückt, ergänzende Sichten aufdeckt, damit seine scheinbare Absolutheit dämpft und in den wogenden Strom des menschlichen Denkens und Sprechens über das Gotteswort zurücksenkt. So wird jetzt, nicht minder eindrucksvoll, die Marienlehre in den umfassenden Rahmen der Gesamt-Kirchenlehre eingebettet.
Aber gerade dieses letzte Beispiel stellt klar vor die Alternative. Was bedeutet hier Relativierung? In welchem Geist, welcher Absicht, welchem Hintergedanken wird sie betrieben? Geht es etwa darum, die marianischen Dogmen unvermerkt verblassen zu lassen, gar zu eskamotieren, indem man andere, bedeutendere Lichter aufsteckt, so wie die Sterne verblassen und verschwinden bei Sonnenaufgang? Soll damit bekundet werden, daß man sich eigentlich doch getäuscht hat, daß nicht nur praktische Unklugheiten und Übertreibungen einseitiger, unerleuchteter Devotion vorkamen (was kein vernünftiger Mensch bestreitet), sondern daß man sich auch theoretisch viel zu weit auf die Äste hinaus gewagt hat? Das wäre die obenerwähnte Methode der Subtraktion oder Nivellierung. Sie ist es, die, wo sie vorausgesetzt wird, die Gemüter hüben und drüben beunruhigt: hüben, weil den Katholiken selber nicht klar wird, wie die Kirche Dinge fahren lassen kann, die sie Jahrhunderte, Jahrtausende lang mit Erbitterung verteidigt hat. Drüben, weil dies allzusehr nach unseriösem, diplomatischem Spiel aussieht, das man einem politisierenden Vatikan wohl zutraut: sollte das Entgegenkommen nicht bloß exoterisch und damit eine Falle sein, die dann sogleich zuschnappt, wenn einer sich ins Innere vorwagt?
Nein, dieser zweite Weg ist ökumenisch nicht zu beschreiten. Es muß der erste, weit anspruchsvollere, geistig anstrengendere Weg zu Ende geschritten werden. Das erfordert aber von den Katholiken eine doppelte intensive theologische Arbeit. Einmal die echte Rezipierung all jener Aspekte der Theologie, Verkündigung und Frömmigkeitsformen, die bei den getrennten Brüdern als echter (wenn auch anderer) Ausdruck der gemeinsam anerkannten christlichen Offenbarung gelten kann. Für die einst so scharf trennende Rechtfertigungslehre ist die nötige Reflexion bereits ein gutes Stück weit erfolgt; sie müßte noch bis zum letzten durchgeführt werden. Dann – dasselbe von der andern Seite her – eine so gründliche Reflexion der eigenen Positionen, daß man, in die eigenen Tiefen dringend, auf die andern Positionen stoßen könnte; dazu aber braucht es eine geistige Anstrengung, die gewiß nicht jedermanns Sache ist, vor allem nicht die des Laien sein kann, deren Denkschritte und Ergebnisse aber doch von den Willigen im großen nachvollziehbar sein müßten, sodaß jeder die Konvergenz begriffe, ohne sich über mogelnde Kompromisse und Diplomatenkniffe beklagen zu können.
Wie sehr aber setzt ein solches Unterfangen voraus, daß beide Gesprächspartner Gott vor sich, und nicht im Rücken haben! Vielmehr auf ihn zu schreiten, als den immer Größeren und Geheimnisvolleren, der, nach Augustins Wort, «unendlich ist, um auch als Gefundener je neu gesucht zu werden (ut inventus quaeratur immensus est) ». Vielleicht beginnen heute die Katholiken, in ihrem Lebensgefühl und religiösen Denken hinreichend erschüttert, allmählich den Sinn dieses Satzes neu zu verstehen. Vielleicht lernen sie aus der Wirklichkeit des ökumenischen Gesprächs, daß sich Offenbarung Gottes nie und nimmer in Flaschen abziehen und in Kellern konservieren läßt, daß die Antworten, die sie aus solchen Lagermagazinen hervorziehen, auf die ganz präzisen heutigen Fragen gar nicht passen, daß trotz kirchlicher Tradition und unfehlbarem Lehramt die Weltgeschichte unerbittlich weiterschreitet, die Schicksalsstunden nur aus einer vollen persönlichen Entscheidung bestanden werden können, und daß – schwere Aufgabe! – die ganze Tradition immer wieder in den geschichtlichen Augenblick eingeschmolzen und auf ihn hin neu begriffen und geformt werden muß. Dann gerade sind wir auch des Beistands des Heiligen Geistes gewiß, dann wird er uns spürbar, dann erscheint uns der Sinn dessen, was wahrhaft Tradition heißt, und was ohne Martyrion, ohne das Wagnis auf Leben und Tod eines Gesamtzeugnisses, nie Gestalt gewinnt.
Was aber ein Christ ist, das müßte in eindringlicher Weise bei solchen Gesprächen vor uns, und nicht etwa als das schon Begriffene, nicht mehr zu Denkende, hinter uns liegen. Ist es doch, wie sich nachher zeigen wird, gerade in diesen Gesprächen noch kontrovers, weil es für den Katholiken just hier darauf ankommt, daß er nicht, sein Plus subtrahierend und preisgebend, kleinbeigibt, sondern nicht ruht, bis er es durchreflektiert hat auf den Kern des Evangeliums.
_______
Quelle: Hans Urs von Balthasar – Wer ist ein Christ? – Offene Wege 1 – Benziger